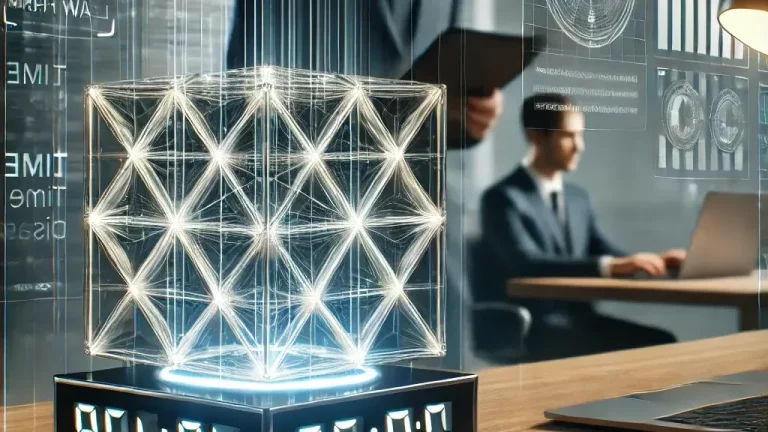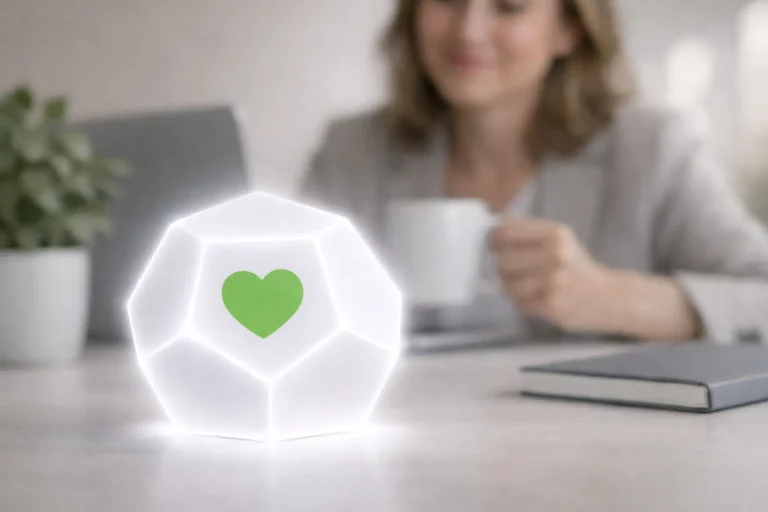Warum Polens Steuerbefreiung für Familien das Falsche richtig macht
Als Polens Präsident Karol Nawrocki im August 2025 das neue Gesetz zur vollständigen Steuerbefreiung für Familien mit mindestens zwei Kindern unterzeichnete, schien das ein großer politischer Wurf zu sein.
Ein Wahlversprechen eingelöst, ein Signal an Familien – und eine Botschaft, die emotional zieht: „Wir entlasten Eltern, die unsere Zukunft tragen.“
Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich:
Das Konzept trifft nicht die, die Unterstützung am dringendsten brauchen.
Das Versprechen: Mehr Geld für Familien, mehr Motivation für Arbeit
Die Idee klingt einfach und sympathisch:
Familien mit zwei oder mehr Kindern sollen keine Einkommenssteuer mehr zahlen bis zu einem gemeinsamen Einkommen von etwa 66.000 Euro jährlich.
Laut Berechnungen des Präsidialamts profitiert eine durchschnittliche Familie mit rund 1.000 PLN (235 €) zusätzlichem Einkommen pro Monat.
Die Ziele:
- Steuerlast verringern
- verfügbares Einkommen erhöhen
- Konsum ankurbeln
- Erwerbstätigkeit fördern
Ein starkes Narrativ, das gesellschaftspolitisch auf Zustimmung stößt.
Doch genau hier liegt das Problem.
Das Problem: Die Steuerfreiheit hilft vor allem den Besserverdienenden
Wer wenig verdient, zahlt ohnehin kaum oder gar keine Einkommenssteuer und bekommt daher auch keine spürbare Entlastung.
Wer mehr verdient, spart dagegen jeden Monat hunderte Euro.
Beispiel:
- Familie mit 7.000 PLN Einkommen → 395 PLN Entlastung
- Familie mit 12.000 PLN Einkommen → 913 PLN Entlastung
Das Ergebnis:
👉 Die Reform wirkt sozial regressiv, sie vergrößert die Lücke zwischen arm und reich, anstatt sie zu schließen.
👉 Der Titel „Familienförderung“ wird so zu einer Steuersubvention für die Mittelschicht und obere Einkommensgruppen.
Finanzielle Realität: Teuer, aber nicht treffsicher
Das Programm kostet laut Finanzministerium bis zu 7 Milliarden Euro jährlich.
Die geplante Gegenfinanzierung durch eine „Verschärfung des Steuersystems“ in Höhe von 3,2 Milliarden Euro gilt unter Experten als unrealistisch.
Damit steht die Frage im Raum:
Wie lange kann sich der Staat eine Maßnahme leisten, die viel kostet, aber wenig bewirkt?
Vergessene Gruppen: Alleinerziehende und Geringverdiener
Ein weiteres Problem:
- Alleinerziehende gehen leer aus.
- Kinderlose Geringverdiener werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
- Niedriglohnfamilien, die ohnehin keine Steuer zahlen, erhalten keinen Cent mehr.
Das ist sozialpolitisch problematisch und politisch riskant. Denn es sendet das Signal:
„Je mehr du verdienst, desto mehr fördern wir dich.“
So ließe sich das System gerechter gestalten
Wenn das Ziel wirklich lautet, Familien zu stärken und Arbeit zu belohnen, muss das Konzept angepasst werden.
Hier sind fünf konkrete Reformvorschläge, die soziale Treffsicherheit und finanzielle Nachhaltigkeit vereinen:
- Einkommensabhängige Staffelung
→ Volle Steuerbefreiung nur bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze (z. B. 5.000 PLN/Monat).
Danach schrittweise Reduktion.
So profitieren alle – aber die mit wenig Geld am meisten. - Kombination aus Steuererleichterung und Kinderbonus
→ Für Familien, die keine Steuern zahlen, könnte ein direkter Zuschuss (z. B. 500–700 PLN monatlich) greifen.
Das schafft reale Entlastung für Geringverdiener. - Zusatzvorteil für Alleinerziehende
→ Ein zusätzlicher Freibetrag oder Bonus würde soziale Ungleichheit abfedern. - Anreiz für Erwerbstätigkeit
→ Steuerbefreiung nur für Eltern mit nachweislicher Erwerbstätigkeit (auch Teilzeit).
So wird Arbeit belohnt – nicht bloß Familienstatus. - Kommunikative Neuausrichtung
→ Weg von „Null-Steuer für Familien“ hin zu
„Familienbonus für Erwerbstätige mit geringem und mittlerem Einkommen“.
Das ist glaubwürdiger, gerechter und wirtschaftlich sinnvoller.
Fazit: Symbolisch stark, sozial schwach
Die Reform von Präsident Nawrocki steht exemplarisch für viele gut gemeinte, aber unpräzise sozialpolitische Maßnahmen:
Sie setzen auf große Gesten, aber verfehlen das Ziel.
Was bleibt, ist die Erkenntnis:
Gerechtigkeit entsteht nicht durch Steuerfreiheit, sondern durch gezielte Entlastung dort, wo sie wirklich gebraucht wird.
Und das wäre nicht nur sozial, sondern auch wirtschaftlich klug.